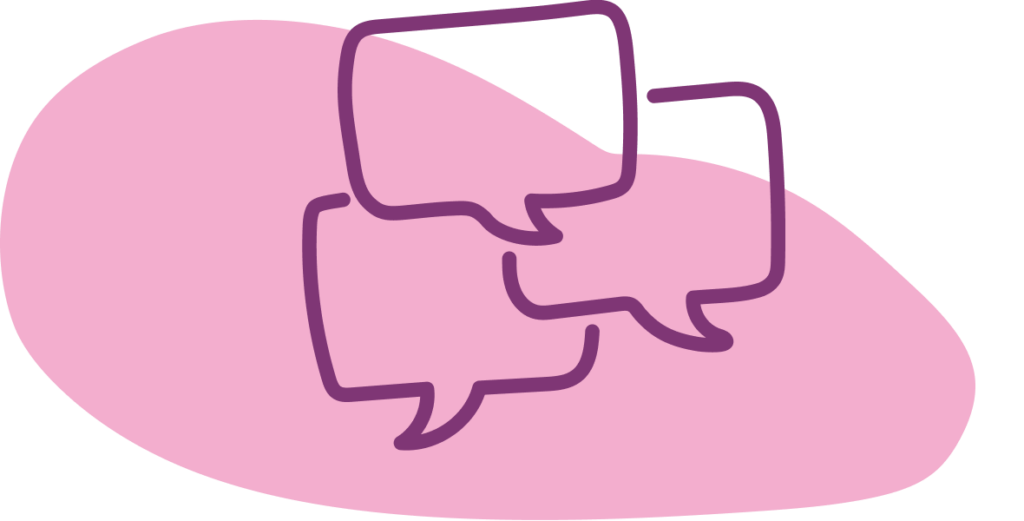
Der Fachkongress mit seinen ca. 250 Fachveranstaltungen zu verschiedensten Themenschwerpunkten fördert die Fort- und Weiterbildung von Fachkräften und setzt vielfältige inhaltliche Impulse. Dafür stehen insgesamt 20 Räume in acht Zeitslots zur Verfügung.
Ergänzend gibt es in der Mittagspause digitale Lunch Break Sessions, die auch denen ein Forum bieten, die nicht vor Ort dabei sein können!
Das Programm werden wir hier im November 2024 veröffentlichen.
Die Veranstaltungen werden die Vielfalt der Kinder- und Jugendhilfe und ihrer Arbeitsfelder abbilden. Im Zentrum steht natürlich das Motto des 18. DJHT:
Weil es ums Ganze geht: Demokratie durch Teilhabe verwirklichen!
Die Einreichung von Veranstaltungen ist abgeschlossen. Aussteller*innen der Fachmesse können noch bis 30. September Messeforen einreichen, d.h. Veranstaltungen auf Flächen in den Messehallen. Weitere Hinweise finden Sie auch unter Informationen für Veranstalter*innen und Aussteller*innen.
Bereits jetzt finden Sie hier unsere Zeitplanung:
Dienstag 13.05.2025
- 12.00-13.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung
- 13.00-14.00 Uhr
Eröffnung der Messe - 13.00-15.00 Uhr
Mittagspause - 13.45-14.45 Uhr
Digitale Lunch Break Session 1 - 15.15-16.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 1 - 17.15-18.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 2
Mittwoch 14.05.2025
- 09.15-10.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 3 - 11.15-12.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 4 - 13.00-15.00 Uhr
Mittagspause - 13.45-14.45 Uhr
Digitale Lunch Break Session 2 - 15.15-16.15 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 5 - 17.15-18.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 6 (ab 20 Uhr Abend der Begegnung)
Donnerstag 15.05.2025
- 09.15-10.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 7 - 11.15-12.45 Uhr
Fachkongress Veranstaltungsslot 8 - 13.00-14.00 Uhr Mittagspause
- 13.00-14.00 Uhr
Digitale Lunch Break Session 3 - 14.00-15.30 Uhr Abschlussveranstaltung
- 15.30 Uhr Ende des DJHT